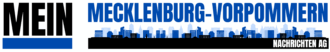Handy-Sucht bei Jugendlichen: Experten schlagen Alarm!
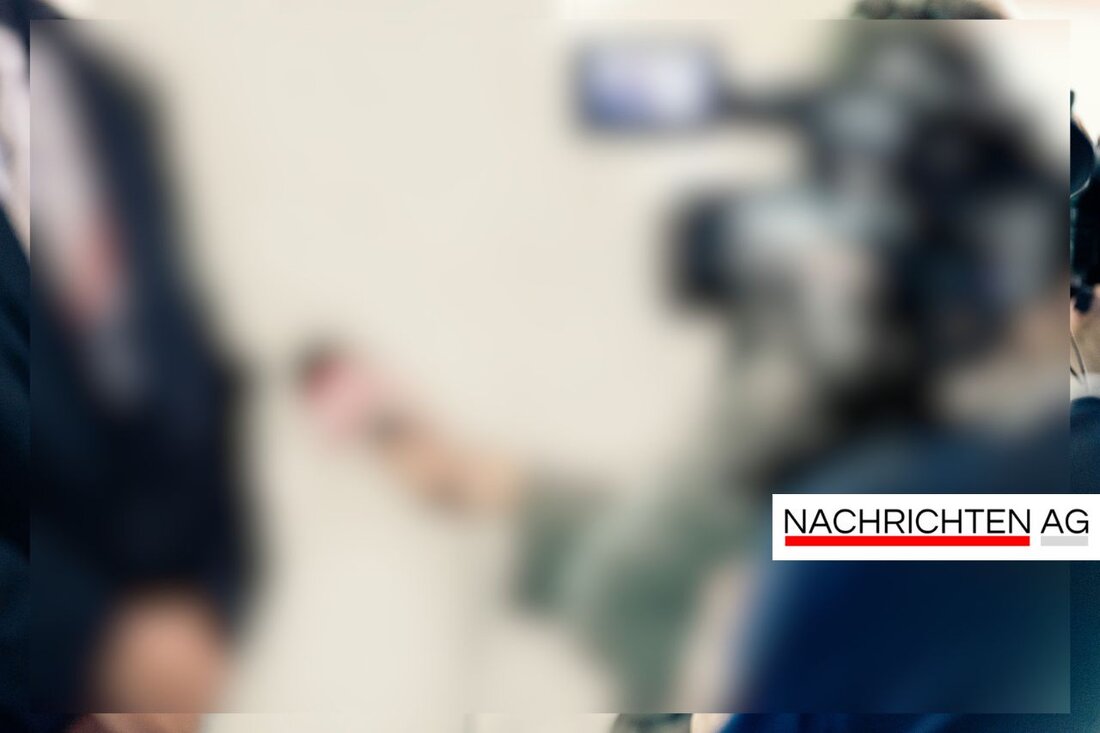
Handy-Sucht bei Jugendlichen: Experten schlagen Alarm!
Stralsund, Deutschland - Immer mehr Kinder und Jugendliche verbringen Stunden vor Bildschirmen – eine Entwicklung, die sowohl Wissenschaftler als auch Eltern besorgt. Laut einer aktuellen Studie der Postbank haben Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ihren täglichen Internetkonsum im Vergleich zu 2023 um mehr als anderthalb Stunden erhöht und verbringen nun rund zehn Stunden täglich online. Diese alarmierenden Zahlen wurden von Hirnforscher Prof. Manfred Spitzer in einem Vortrag in Stralsund aufgegriffen, wo er die negativen Auswirkungen digitaler Medien auf die Bildung thematisierte. Besonders prekär ist die Warnung Spitzer über die drohende "digitale Demenz", die durch Mangel an Wiederholungen, Kontext und Relevanz im Lernen gefördert wird.
Doch das Problem ist nicht nur im Klassenzimmer zu spüren. Spitzer wies darauf hin, dass laut einer Studie des Karolinska-Instituts digitale Medien im Unterricht nicht das Lernen fördern, sondern vielmehr die Konzentration schmälern. Besorgte Eltern haben die wachsenden Probleme durch Handys und Tablets schon lange festgestellt. Fast jeder vierte Jugendliche zeigt Anzeichen einer Handysucht, die mit physischen Beschwerden wie Haltungsschäden und Kurzsichtigkeit einhergeht. Auch das Bildungsministerium hat das Thema auf den Radar: Es empfiehlt eine klare Regelung für den Handynutzungsunterricht für die Klassen eins bis neun, ohne jedoch ein pauschales Verbot auszusprechen.
Ältere Generationen im Fokus
Die Diskussion über digitale Medien hat jedoch auch eine andere Seite. Eine Metaanalyse neurowissenschaftlicher Studien, veröffentlicht in Nature Human Behaviour, legt nahe, dass digitale Medien möglicherweise das Demenzrisiko sogar senken könnten. Hier wird zwischen der Hypothese der "digitalen Demenz", die behauptet, dass der Umgang mit Technologien kognitive Fähigkeiten absenkt, und der "technologischen Reserve", die den positiven Einfluss digitaler Medien auf die Kognition betont, unterschieden. Die Analyse, die Daten von über 411.000 Personen ab 50 Jahren berücksichtigte, zeigte, dass der Umgang mit digitalen Technologien als kognitive Herausforderung betrachtet werden kann, die das Gehirn trainiert.
Während diese Erkenntnisse den älteren Generationen zugutekommen könnten, bleiben die langfristigen Auswirkungen auf die "Digital Natives" unklar. In einer Zeit, in der soziale Netzwerke und Online-Spiele hoch im Kurs sind, sind über ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen anfällig für problematischen Medienkonsum. Zahlen zeigen, dass die durchschnittliche Nutzung von Social Media pro Wochentag auf etwa 2,5 Stunden gestiegen ist, wobei 12 % der Kinder und Jugendlichen digitale Spiele in problematischem Maße nutzen.
Ein Wettlauf gegen die Zeit
Neurobiologen und Psychologen warnen eindringlich vor den psychischen Auswirkungen einer übermäßigen Nutzung sozialer Medien. Während einige Studien geringe Korrelationen zwischen Mediennutzung und Wohlbefinden feststellen, ist die Befürchtung groß, dass Einsamkeit, Stress und psychische Erkrankungen zunehmen werden. Besonders die manipulativen Designs auf Plattformen, die auf das Belohnungssystem des Gehirns abzielen, intensivieren die Probleme der Jugendlichen im Umgang mit digitalen Medien. Daneben fordern zahlreiche Experten, dass digitale Bildung und Medienkompetenz verstärkt in den Bildungsplan integriert werden müssen.
Um Eltern zu unterstützen, gibt es auch Empfehlungen zu Bildschirmzeiten: Für Kinder unter drei Jahren ist keine Bildschirmzeit vorgesehen, während für ältere Kinder und Jugendliche Begrenzungen von maximal 30 bis 45 Minuten pro Tag empfohlen werden. Inmitten all dieser Entwicklungen ist es unerlässlich, klare Regeln und Begleitung durch Eltern zu fördern, damit Kinder und Jugendliche nicht im digitalen Dschungel verloren gehen. Die Zukunft der digitalen Medien erfordert ein gutes Händchen sowohl von Erziehern als auch von Eltern, um einen gesunden Umgang damit zu ermöglichen.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Stralsund, Deutschland |
| Quellen | |