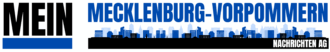80 Jahre Kriegsende: Vortrag über Rügens Gutsherren und ihre Schicksale
Am 12. Juli hält Christian Biskup im Stadtmuseum Bergen einen Vortrag über das Kriegsende 1945 und die Folgen auf Rügen.

80 Jahre Kriegsende: Vortrag über Rügens Gutsherren und ihre Schicksale
Am 12. Juli wird im Stadtmuseum Bergen ein besonders aufschlussreicher Vortrag von Gutshausforscher Christian Biskup stattfinden. Anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs wird er die Situation auf den Gütern der Insel Rügen beleuchten. Geschichtsstudien zeigen, dass das Kriegsende 1945 für viele Gutsherren und Arbeiter ein Wendepunkt war. In den Berichten von Zeitzeugen, die ihre Erlebnisse rund um den Mai 1945 schildern, wird deutlich, wie die Ereignisse das Leben der Menschen verändert haben. Biskup wird auch die Geschichte der Gutsherrschaft in den Fokus rücken und den Bedeutungsverlust des Adels nach dem Krieg thematisieren. Besonders erwähnt werden die Familien Putzier aus Dumsevitz, Klöckner aus Klein Bandelvitz und von Gagern aus Frankenthal, die exemplarisch für den Wandel stehen, den diese Phase mit sich brachte.
Die Bodenreform als entscheidender Schritt
Im Herbst 1945 trat die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) in Kraft, die zur Enteignung von Gutsbesitzern führte. Diese Maßnahme zielte nicht nur auf Nazi-Anhänger ab, sondern betraf auch unschuldige Grundbesitzer mit über 100 Hektar Land. Betroffene wie Horst Pätzold können ein Lied davon singen: Seine Eltern wurden enteignet, als er 18 Jahre alt war. Sein Vater hatte nach dem Ersten Weltkrieg ein 169 Hektar großes Gut, das seine Familie über Jahre hinweg betrieben hatte. Am 2. Oktober 1945 musste seine Mutter das Gut mit nur wenigen Besitztümern verlassen. Solche Schicksale waren zahlreich und zeigen, wie unterschiedlich die Auswirkungen der Reform waren, während viele Menschen, die von der Enteignung betroffen waren, oft ohne Entschädigung blieben.
Die Reform führte zur Verteilung von 3,298 Millionen Hektar an etwa 560.000 „Bodenempfänger“. Diese Neubauern erhielten das Land als persönliches, vererbbares Eigentum. Gleichzeitig wurde ein Drittel zum Staatsbesitz erklärt. Es war eine tiefgreifende Umwälzung, die nicht nur den Besitz, sondern oft auch die Heimat und Identität der Enteigneten in Frage stellte. Auch Heinrich Graf von Bassewitz erinnert sich an die Enteignung seines Familienguts Dalwitz, welches seit 1349 im Familienbesitz war. Seine Rückkehr nach der Wende und der symbolische Kauf des maroden Gutshauses für zehn D-Mark zeigen, dass nicht alle Geschichten mit einem Verlust enden mussten. Heute betreibt von Bassewitz eine Öko-Rinderzucht und schafft Arbeitsplätze in seiner Gemeinde.
Die bleibende Diskussion um die Enteignungen
Trotz der positiven Entwicklungen für einige Rückkehrer bleibt das Thema der Bodenreform umstritten. Nach der Wiedervereinigung forderten viele ehemalige Gutsbesitzer Entschädigungen, doch dies wurde häufig abgelehnt. 1991 bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Rechtmäßigkeit der Bodenreform. Die Diskussion über Besitztümer, die Unrechtsstaatlichkeiten und Entschädigungen ist bis heute ein heißes Eisen, das viele Gemüter bewegt. Auch das Bundesverwaltungsgericht erkannte die schwerwiegenden Vergehen gegenüber enteigneten Eigentümern an, was zeigt, wie tief die Wunden noch sitzen.
Der kommende Vortrag von Christian Biskup wird somit nicht nur einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen, sondern auch ein Raum für die Auseinandersetzung mit den dauerhaften Folgen dieser historischen Ereignisse bieten. Für jeden, der sich für die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns interessiert, dürfte dies eine einmalige Gelegenheit sein, mehr über die dramatischen Veränderungen, die der Krieg mit sich brachte, zu erfahren.
Weitere Details können auf der Seite von auf-nach-mv.de nachgelesen werden. Ebenso bietet die Webseite ndr.de ausführliche Informationen zur Bodenreform, während du auf Wikipedia noch tiefere Einblicke in die Thematik erhalten kannst.